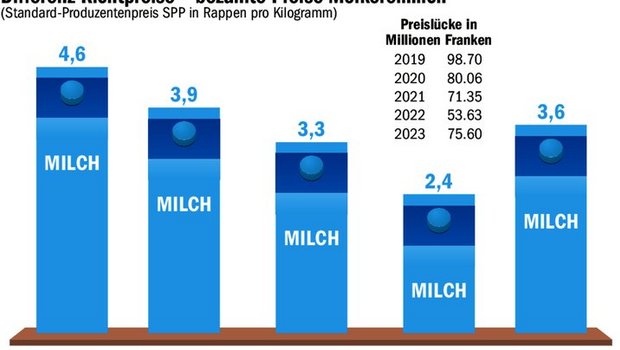Eigentlich forscht die Schweiz gerne. Was die Zellzahlen in der Milch anbelangt, scheint sie aber gerne etwas zurückhaltend zu sein.
Im Jahr 2021 hat der Bund insgesamt 24,6 Milliarden Franken für Forschung und Entwicklung (F+E) aufgewendet. Das entspreche gegenüber der letzten Erhebung von 2019 einer durchschnittlichen jährlichen Zunahme von 4 Prozent, gibt das Bundesamtes für Statistik bekannt. Es wird also immer mehr geforscht.
Auch die Anzahl Beschäftigter in diesem Bereich ist entsprechend hoch. Insgesamt waren 2021 knapp 140'000 Personen daran beteiligt. Im internationalen Vergleich gehöre die Schweiz zu den Volkswirtschaften mit der höchsten F+E-Intensität.
Viel Forschung
Wir wollten wissen, welchen Stellenwert die Landwirtschaft dabei hat. Explizit aufgeschlüsselt werde das nicht, heisst es beim Bundesamt auf Anfrage. Vielmehr wird unterschieden, ob die Gelder in die Privatwirtschaft, in Bundesinstitutionen oder in Hochschulen fliessen. Klar ist: Ein bedeutender Anteil fliesst in die Pharmaforschung, und diese ist wiederum zu einem sehr grossen Teil in der Privatwirtschaft angesiedelt.
Spitzenreiter ist die Landwirtschaft bei den Ausgaben für Bundesinstitutionen. Hier dürften Agroscope, das Kompetenzzentrum des Bundes für landwirtschaftliche Forschung, und das Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) in erster Linie mit ihren Aufwendungen zu Buche schlagen. Diese werden in der Statistik von 2021 mit 148.65 Mio Fr. beziffert.
Es scheint an der Forschung also nicht gespart zu werden in der Schweiz.
Viel Antibiotikum
Gespart wird auch nicht im Bereich des Antibiotikumeinsatzes. Obschon die Schweiz ihren Verbrauch im Nutztierbereich im vergangenen Jahrzehnt halbiert hat, ist der Einsatz im Vergleich zum Ausland nach wie vor sehr hoch. Nach Veröffentlichung der Zahlen aus dem letzten Bericht des Informationssystems Antibiotika in der Veterinärmedizin (IS ABV) rückte insbesondere das Milchvieh in den Fokus. Und hier zeigt der Vergleich mit dem Ausland wiederum, dass in der Schweiz viele Kühe wegen Euterproblemen behandelt werden.
Hohe Zellzahlen
Wir wollten von Michèle Bodmer, Tierärztin und Leiterin der Bestandesmedizin Rind in Bern, wissen, woran das liegen könnte. «Der Mehrverbrauch in der Schweiz hat mit grosser Wahrscheinlichkeit damit zu tun, dass wir auch subklinische Mastitiden, also Kühe mit hohen Zellzahlen ohne weitere Symptome, systematisch in der Laktation behandeln», erklärt sie. Das werde zumindest zum Teil aufgrund der sehr strengen Bonuslimiten und Bestrafungsgrenzen verbunden mit den kleinen Herden gemacht. Denn wenn in einer Herde mit 25 Kühen drei Kühe eine erhöhte Zellzahl hätten und noch viel Milch geben würden, sei man im Tank relativ rasch einmal an der kritischen Grenze mit den Zellen. «Das gilt vor allem bei Käsereibetrieben, wo die Anforderungen der Käser an die Milch sehr streng sind», so Bodmer.
Gefragt nach Lösungsansätzen, verweist Michèle Bodmer an die Forschung zur Zellzahl in der Verarbeitungsmilch und die Folgen auf Käseausbeute und Käsequalität. Ihrer Meinung nach müsste man rausfinden, wo wirklich die Grenze liegt, und nicht einfach nach dem Motto «tiefer gleich besser» arbeiten.
Gefragt nach der Institution, die entsprechend forschen sollte, sagt Bodmer: «Das ist eindeutig ein Thema für Agroscope.» Es gäbe dazu bereits ältere Arbeiten, die rund 30 bis 40 Jahre alt seien. «Es ist an der Zeit, dass dies wieder mal untersucht wird, da sich auch gewisse Verarbeitungsprotokolle verändert hätten», erklärt sie.
Zucht müsste reagieren
In der Zucht könnte laut der Tierärztin ebenfalls recht viel erreicht werden, wie beispielsweise die Skandinavier gezeigt hätten. «Für die Zucht auf Mastitisresistenz reicht es aber nicht aus, auf das Merkmal tiefe Zellzahlen zu selektionieren, dafür müssen mehrere Merkmale mit einbezogen werden, deshalb wäre es auch so wichtig, die Mastitiden im elektronischen Behandlungsjournal der Zuchtverbände zu erfassen», ist Michèle Bodmer sicher. Die Zuchtverbände hätten diesen Trend (Fitnesszuchtwerte) wahr-genommen, und da werde auch schon einiges berechnet. Leider sei die Datengrundlage betreffend Erfassung der Diagnosen (im digitalen Behandlungsjournal) durch die Züchter nicht optimal. «Da gibt es noch sehr viel Verbesserungspotenzial», ist sie sicher.